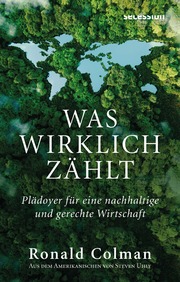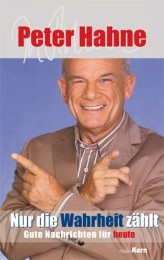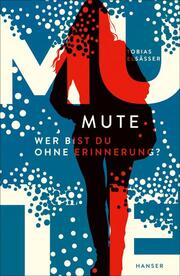Beschreibung
Vorwort Fragt man Menschen in Deutschland, ob sie glauben, dass ihre Stimme im politischen Prozess zählt, fällt die Antwort gemischt aus - vor allem aber hängt sie davon ab, wie es um die soziale und ökonomische Situation der Befragten bestellt ist. Während im unteren Einkommensfünftel fast 40 Prozent starke Zustimmung zu der Aussage äußern, keinen Einfluss auf Regierungsentscheidungen zu haben, sind es bei den Angehörigen der oberen Mittelschicht nur ungefähr 13 Prozent (ALLBUS 2016). Das in weniger privilegierten Gesellschaftsschichten verbreitete Gefühl der politischen Einflusslosigkeit findet seinen Ausdruck auch in der zunehmenden Wahlenthaltung dieser Bürgerinnen und Bürger. Ausgehend von diesen Beobachtungen habe ich mich in den letzten Jahren mit der Frage auseinandergesetzt, wie soziale Ungleichheit und politische Repräsentation in Deutschland zusammenhängen. Auf Basis meiner Untersuchung argumentiere ich in den folgenden Kapiteln, dass die verbreitete Einschätzung in unteren Berufs- und Einkommensgruppen, mit den eigenen politischen Anliegen weniger Gehör zu finden, nicht unbegründet ist - was nicht nur die Legitimität der Demokratie gefährdet, sondern auch gravierende Folgen für die inhaltliche Ausrichtung der Politik hat. Dieses Buch ist eine überarbeitete Fassung meiner Dissertationsschrift, die größtenteils am Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung (MPIfG) in Köln entstanden ist. Als ich im Herbst 2011 als studentische Hilfskraft zum ersten Mal meinen Fuß in das Institut setzte, konnte ich noch nicht ahnen, dass ich es erst sechs Jahre später - mit einer fertigen Dissertation in den Händen - wieder verlassen würde. Noch weniger aber ahnte ich damals, wie sehr mich die Menschen, denen ich im Laufe der Zeit an diesem Institut begegnet bin, in meinem wissenschaftlichen Denken und Werdegang prägen würden. Dass ich von meinem Studienfach der Volkswirtschaftslehre, in der ich mich nie wirklich zuhause gefühlt habe, schließlich zur politischen Ökonomie gekommen bin, ist sicherlich diesen bedeutenden Jahren geschuldet. Mein besonderer Dank gilt deshalb Wolfgang Streeck, der mir in den ersten drei Jahren am Institut viel Vertrauen und Unterstützung geschenkt und mich ermutigt hat, diesen Weg einzuschlagen. Dass ich auch während meiner Promotionszeit am MPIfG angegliedert bleiben durfte, ist Ergebnis der großzügigen Unterstützung von Jens Beckert. Mein größter Dank gilt Armin Schäfer, der nicht nur diese Dissertation hervorragend betreut hat, sondern auch darüber hinaus ein wichtiger Austauschpartner geworden ist. Seine ansteckende Begeisterung und die Überzeugung, mit wissenschaftlicher Arbeit auch Gesellschaft verändern zu können, haben mich nicht nur in der Dissertationsphase immer wieder motiviert, sondern werden mir auch in Zukunft weiter Vorbild sein. Silja Häusermann, die das Zweitgutachten erstellt hat, hat der Arbeit viel Aufmerksamkeit und Zeit geschenkt - die Überarbeitung des Manuskripts hat stark von ihren scharfsinnigen Anmerkungen und Verbesserungsvorschlägen profitiert. Zum Gelingen der Dissertation haben zweifellos die vielen tollen Kolleginnen und Kollegen am MPIfG beigetragen, die in den richtigen Momenten ein offenes Ohr, eine gute Idee, motivierende Worte oder einfach nur die Zeit für eine gemeinsame Arbeitspause hatten - insbesondere Timur Ergen, Jiska Gojowcyk, Lukas Haffert, Annina Hering, Martin Höpner, Marina Hübner, Daniel Mertens, Inga Rademacher und Martin Seeliger. Das Gleiche gilt für die Kolleginnen und Kollegen in den Servicegruppen, die durch ihre professionelle Arbeit am MPIfG ein Forschungsumfeld schaffen, das seinesgleichen sucht. Besonderer Dank gebührt zudem meiner Osnabrücker Kollegin Svenja Hense, die mir nicht nur mit großem Einsatz und Zuverlässigkeit bei der Erstellung der Daten geholfen hat, sondern auch darüber hinaus eine wichtige Wegbegleiterin war. Schließlich habe ich mich sehr über die Unterstützung derjenigen gefreut, die in der Endphase der Dissertation einzelne Kapitel der Arbeit durchgearbeitet und mit hilfreichen Verbesserungsvorschlägen versehen haben: Julian Bank, Max Bank, Timur Ergen, Jiska Gojowczyk, Lukas Haffert, Svenja Hense und Annina Hering - vielen Dank! Schließlich möchte ich mich bei all den wichtigen Menschen außerhalb der Wissenschaft bedanken, die während der letzten Jahre - bewusst oder unbewusst - dabei geholfen haben, neben dem Schreiben alles andere Wichtige nicht zu kurz kommen zu lassen. Mein größter Dank gilt hier Max Bank, der mich vor allem am Ende der Promotionszeit so unermüdlich und liebevoll begleitet hat, wie man es sich wohl nur wünschen kann. Ich widme dieses Buch meinen Eltern, denn sie sind ohne Zweifel meine langjährigsten Unterstützer. Köln, im August 2018 Lea Elsässer ? Kapitel 1 Einleitung Der Slogan der britischen Labour-Partei, mit dem die Sozialdemokraten unter Jeremy Corbyn 2017 in den Wahlkampf zogen, war so simpel wie einprägsam: for the many, not the few. Politik für die vielen, nicht nur für wenige - die zentrale Botschaft dieser Wahlkampagne barg das Versprechen, die ökonomischen und sozialen Interessen der unteren und mittleren gesellschaftlichen Schichten wieder verstärkt in den Mittelpunkt zu rücken, die Austeritätspolitik der Vorgängerregierungen zu beenden und sich für mehr Umverteilung und eine (Rück-)Verstaatlichung zentraler Dienstleistungen einzusetzen (Labour Party 2017). Gleichzeitig knüpfte das Wahlkampfmotto bewusst an das verbreitete Gefühl vieler Menschen an, von der Politik und ihren Institutionen nicht mehr repräsentiert zu werden, sondern von Parteien regiert zu sein, die vor allem im Sinne der ökonomisch Privilegierten entscheiden. Entgegen der anfänglichen Erwartung vieler, auch aus der Führungsriege der eigenen Partei, erzielte Corbyn mit seiner Kampagne einen großen Erfolg und konnte die Anzahl der Sitze im britischen Unterhaus deutlich ausbauen. Dass Politik nur für "die wenigen" gemacht wird, ist eine weit über Großbritannien hinaus verbreitete Einschätzung - vor allem in unteren sozialen Gesellschaftsschichten. Das Misstrauen gegenüber Politikern und Parteien ist in unteren Einkommensgruppen besonders groß; gleichzeitig ist der Glaube daran klein, mit der eigenen Beteiligung Einfluss auf politische Entscheidungen nehmen zu können (Merkel 2015; Schäfer 2015, 109). Und diejenigen, die das Vertrauen in die Politik größtenteils verloren haben, beteiligen sich auch immer weniger am politischen Prozess. So ist in den letzten Jahrzehnten in den meisten OECD-Demokratien eine starke soziale Spaltung in der Wahlteilnahme und anderen politischen Partizipationsformen zu beobachten (Schäfer 2015; Solt 2008). Im Zuge der ansteigenden ökonomischen Ungleichheit haben sich sozial Benachteiligte, prekär Beschäftigte, Geringverdienende und Arbeitslose vielerorts von der Politik abgewendet. Anknüpfend an diese Befunde zeigt die vorliegende Arbeit am Beispiel Deutschlands, dass die Einschätzung vieler Menschen, in der Politik kein Gehör zu finden, eine empirisch belastbare Grundlage hat. In einer umfassenden Untersuchung der politischen Repräsentation in Deutschland gehe ich der Frage nach, ob und durch welche Mechanismen sich die Präferenzen oberer sozialer Klassen stärker in den politischen Entscheidungen des Deutschen Bundestages widerspiegeln als die der sozial Benachteiligten und welche ökonomischen und politischen Konsequenzen dies nach sich zieht. Damit trägt die Studie zu der größeren sozialwissenschaftlichen Debatte um die politischen Auswirkungen steigender sozialer Ungleichheit in westlichen Demokratien bei. 1.1 Politische Folgen sozialer Ungleichheit Das der Demokratie zugrunde liegende Gleichheitsprinzip verlangt, dass die Anliegen aller Mitglieder die gleiche Chance haben, im politischen Prozess berücksichtigt zu werden - ungeachtet der Unterschiede zwischen ihnen. Liberale Demokratien sind deshalb einer ständigen Spannung ausgesetzt, denn sie produzieren aufgrund ihrer kapitalistischen Verfassthe...
Wie steht es um die politische Gleichheit in Gesellschaften, in denen Einkommen immer weiter auseinanderdriften und die Armen sich kaum noch politisch beteiligen? Wessen Stimme findet Gehör? Mit einer umfassenden empirischen Untersuchung politischer Repräsentation in Deutschland zeigt die Autorin, dass die Entscheidungen des Deutschen Bundestages seit den 1980er-Jahren systematisch zugunsten oberer Berufs- und Einkommensgruppen verzerrt sind. In der Folge wird nicht nur das Gleichheitsversprechen der Demokratie verletzt, sondern es werden auch vermehrt Entscheidungen getroffen, die ökonomische Ungleichheit tendenziell verschärfen. Das Buch wurde 2019 mit dem Wilhelm-Liebknecht-Preis der Stadt Gießen ausgezeichnet. Ausgewählt für die Shortlist des Opus Primum - Förderpreis der VolkswagenStiftung für die beste Nachwuchspublikation des Jahres 2019
Autorenporträt
Lea Elsässer ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Sozioökonomie an der Universität Duisburg-Essen.
Herstellerkennzeichnung:
Beltz Verlagsgruppe GmbH & Co. KG
Werderstr. 10
69469 Weinheim
DE
E-Mail: info@campus.de